Hirnforschung
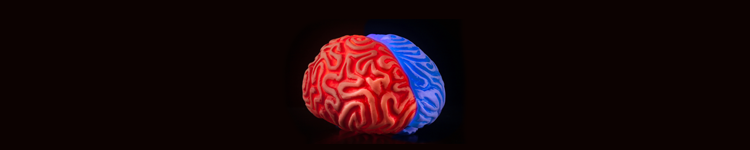
Der, die, das Gehirn – hat das Denken ein Geschlecht?
Kann eine Pathologin feststellen, ob das Gehirn auf ihrem Labortisch von einem Mann oder einer Frau stammt? Kann ein Radiologe an einem Gehirnscan das Geschlecht einer Person ablesen?
Unter Forschenden wird kontrovers diskutiert, ob sich die Denkorgane der Geschlechter grundsätzlich unterscheiden. Denn damit wird auch die Frage berührt, ob Männer und Frauen aus biologischen Gründen unterschiedlich denken oder ob Unterschiede nur auf ihre Sozialisierung zurückzuführen sind.
Zum Thema habe ich auch einen Artikel bei den Riffreportern geschrieben.

Wer den Rhythmus wirklich fühlt
Gibt es ein Schlagzeuger-Gen? Erstmals haben Forschende im Erbgut danach gesucht. Es zeigt sich: Relevante Gene sind auch für den Schlaf oder das Zeitempfinden wichtig.
Können Sie zu einem musikalischen Rhythmus klatschen? Dass die Mehrheit der Menschen dazu in der Lage ist, zeigen nicht nur die Volksmusiksendungen im Fernsehen. Auch in einer Studie, die gerade in der Zeitschrift Nature Human Behavior veröffentlicht wurde (Niarchou et al., 2022), sagten 92 Prozent der Teilnehmer, sie könnten das. Das Ziel der wissenschaftlichen Arbeit war es, genetische Unterschiede zwischen Menschen mit gutem und schlechtem Rhythmusgefühl zu finden. Und tatsächlich fanden die Forschenden an 67 Positionen im menschlichen Erbgut Gene, die möglicherweise zu einem Rhythmusgefühl beitragen. Dies ist das erste Mal, dass in einer genomweiten Suche (genome wide association study, GWAS) Erbfaktoren für musikalische Fähigkeiten identifiziert werden konnten …

Schräge Töne
Zu dem Thema habe ich auch ein 40-minütiges Feature für den Deutschlandfunk produziert, das man hier hören kann!
Die Zeit
Sozialer Kitt, Flirt-Hilfe oder Abfallprodukt der Evolution? Forscher streiten darüber, wozu Musik eigentlich gut ist.
Es gibt keine menschliche Kultur, in der nicht musiziert wird. Schon Babys werden von Musik magisch angezogen, die Musikalität ist offenbar fast jedem Menschen angeboren. Es ist eine faszinierende Fähigkeit: Wir können Töne unterscheiden, deren Frequenzen nur minimal voneinander abweichen. Unser Rhythmusgefühl merkt auf, wenn ein Schlagzeuger mit seinen Beats um ein paar Millisekunden danebenliegt. Und wir erkennen unsere Lieblingssongs schon, wenn wir einen Ausschnitt hören, der nur wenige Zehntelsekunden lang ist. Offenbar hat sich diese Fähigkeit im Lauf der Evolution herausgebildet – aber wozu, welchen Überlebensvorteil bietet sie? Bei der Sprache ist die Sache klar, für die Musik fehlte bislang eine überzeugende Antwort.
„Wenn die bisherigen Erklärungen unbefriedigend sind, kannst du dich beschweren – oder du gehst hin und entwickelst eine befriedigendere Erklärung“, sagt der Musikwissenschaftler Samuel Mehr von der Harvard-Universität. „Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden.“ Genau das haben auch andere getan. Und inzwischen gibt es darum gleich mehrere Antworten auf die Frage nach dem evolutionären Ursprung der Musik – und Streit unter Musikforschern und -forscherinnen.
weiterlesenKontrollierte Halluzination
Simons Institute for the Theory of Computing
In diesem 18-Minuten-Film, für den ich das Drehbuch geschrieben und Regie geführt habe, erklärt der Hirnforscher Bruno Olshausen, wie wir optische Eindrücke in unserem Gehirn verarbeiten – und wie der statistische Satz von Bayes eine Erklärung für optische Täuschungen geben kann.

Der Soundtrack des Lebens – Wie wir uns an Musik erinnern
SWR2
„Schatz, sie spielen unser Lied!“ – Wohl jeder hat es schon einmal erlebt, dass eine Melodie mit einem Schlag Erinnerungen weckt. Nicht nur an die Musik selbst, sondern an die Gefühle, die wir mit ihr verbinden.
Wir alle speichern Tausende von Melodien im Gehirn. Diese Erinnerungen sind erstaunlich präzise und binnen Millisekunden abrufbar, und sie gehören zu den letzten, die Alzheimer-Patienten noch haben. Wie funktioniert dieses musikalische Gedächtnis?
Ein musikalisches Feature bei SWR2 Wissen.

Macht Musik wirklich klüger?
Die Zeit
Ein weiterer Beitrag beim Deutschlandfunk, Forschung Aktuell
Ein englischsprachiger Artikel im Onlinemagazin Undark
Wer ein Instrument lernt, wird dadurch allgemein leistungsfähiger, behaupten viele Studien. Doch an denen muss man zweifeln.
Schlau durch Musik: Das Erlernen eines Instruments fördert nicht nur die Musikalität eines Kindes, sondern auch die abstrakte Vorstellungskraft, seine Mathematik- oder Sprachfähigkeiten. Solche Sätze liest man immer wieder, und tatsächlich behaupten diverse wissenschaftliche Studien, den allgemeinen Bildungseffekt des Musikunterrichts zu belegen – sehr zur Freude von Musiklehrern und bildungsbürgerlichen Eltern. Dabei geht es um sogenannte Transferleistungen unseres Gehirns, also darum, dass Übung auf einem Gebiet die Leistungen auf einem anderen fördert. Meist vergleichen die wissenschaftlichen Untersuchungen Kinder, die Musikunterricht hatten, mit Nichtmusikern. Finden sich Unterschiede, seien diese – so die Schlussfolgerung – durch die Musikstunden zustande gekommen.
Dem kanadischen Psychologen und Komponisten Glenn Schellenberg sind solche Studien ein Dorn im Auge. Denn sie begehen einen klassischen wissenschaftlichen Fehler: Sie verwechseln eine Korrelation (Kinder, die Klavier spielen, sind klüger) mit einer Kausalität (die Kinder sind klüger, weil sie Klavier spielen).
weiterlesen100 Sekunden Wissen: Encephalophon
SRF2
Ein Instrument zu erlernen erfordert jahrelange Übung. Vor allem Anfänger sind oft frustriert, weil sie die Musik, die sie sich vorstellen, nicht aufs Instrument übertragen können. Wäre es nicht toll, wenn wir eine Melodie nur denken müssten, und schon käme sie aus dem Instrument heraus? Über einen Versuch, diese Fantasie technisch umzusetzen.
(Peinlich: Ich habe mich verplappert und EKG statt EEG gesagt.)
Beitrag anhören
Im Hirn der Pianisten
Die Zeit
Jeder kann das Musizieren lernen, aber nicht jeder gleich schnell. Gibt es doch ein angeborenes Talent?
Wie komme ich zur Philharmonie? – „Üben, junger Mann, üben!“ Der etwas betagte Witz gibt eine Weisheit wieder, die vor allem in populären psychologischen Büchern in den vergangenen Jahren gern verbreitet wurde: Übung mache den Meister, genauer gesagt 10.000 Stunden Übung. Diese Zahl tauchte zuerst 1993 in einer Arbeit des schwedischen Psychologen K. Anders Ericsson auf und wurde popularisiert durch das Buch Überflieger des Journalisten Malcolm Gladwell. Mozart, so Gladwell, absolvierte unter der Fuchtel seines Vaters seine 10.000 Stunden schon im frühen Kindesalter, die Beatles sammelten ihre in den schmuddeligen Kellerbars der Hamburger Reeperbahn.
Davon wollte insbesondere die musikpsychologische Forschung zuletzt wenig wissen, sie betonte vielmehr, dass Musikalität eine allgemeine menschliche Fähigkeit sei. Jetzt aber erregt die Neurowissenschaftlerin Sibylle Herholz vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in Bonn Aufsehen mit einer Studie, die gerade in der Zeitschrift Cerebral Cortex erschienen ist. Herholz behauptet, einen möglichen Sitz des Talents im Gehirn identifiziert zu haben …
Der Gänsehaut-Effekt
Die Zeit
Warum erzeugt Musik überhaupt Gefühle? Einige Erklärungsversuche der Wissenschaft.
Musik kann in uns hineinfahren wie ein Blitz. Sie kann zu Tränen rühren, zum ausgelassenen Tanzen verführen, uns an Orte und in vergangene Zeiten zurückführen. Wie kann das sein? Sprache, die mit der Musik sehr verwandt ist, erreicht uns immer über das Bewusstsein. Doch Musik trifft uns ganz unmittelbar, ohne dass wir ihren Inhalt analysieren müssen. Wie macht Musik das, was sie macht?
Musik ist ein globales Phänomen des Gehirns, haben Hirnforscher und Psychologen in den letzten Jahren erkannt, und das macht sie besonders interessant. Forschungszentren, die sich traditionell mit Sprache beschäftigen, etwa das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, haben Programme zum Thema Musikkognition aufgelegt, und da interessiert vor allem die emotionale Wirkung der Töne. „Musik ist die Sprache der Gefühle“, das ist nicht mehr nur ein romantisches Klischee, sondern ein wörtlich zu nehmender Forschungsansatz …
Immer die erste Geige
Die Zeit
Stefan Koelsch untersucht den Sinn für Musik. Der Forscher weiß: Jeder Mensch hat ihn. Er steckt in unserem Kopf.
Stefan Koelsch ist zufrieden. »Das ist gut gelaufen für mich«, sagt er beim Frühstück in einem Hotel in Montreal. Hinter ihm liegen drei Tage Konferenz, er hat ein gewaltiges Schlafdefizit angehäuft. Aber auch an diesem Morgen wirkt er wie aus dem Ei gepellt, das Haar akkurat gescheitelt. Nur die Antworten kommen nicht ganz so aus der Pistole geschossen wie sonst.