Autor: cd

»Telefonspiel« mit Melodien
Wie wird Musik von Mensch zu Mensch weitergegeben, wenn es keine Noten und keine Tonträger gibt? Forscher haben ein großes Online-Experiment dazu gemacht.
Woher kommen die Melodien? In unserer Kultur lautet die Standardantwort: Ein Komponist oder eine Komponistin hat sie sich ausgedacht, vielleicht zu Papier gebracht, dann wird das Lied im Studio mit Profimusikern aufgenommen, und wir hören es im Radio oder über Streamingdienste.
Aber es gibt noch viele alte Volkslieder, die von keinem einzelnen Menschen erschaffen, sondern von Generation zu Generation mündlich weitergegeben wurden. In manchen Kulturkreisen ist das heute noch so. Gibt es dabei Gesetzmässigkeiten? Das wollte ein internationales Team von Musikforschern herausfinden …

Debatte um den Weg zum Wasserstoff
Die USA waren lange Zeit ein Bremser, was Maßnahmen zum Klimaschutz angeht. Nun aber hat Präsident Biden ein Milliardenprogramm zur Förderung einer klimafreundlichen Energiewirtschaft angestoßen, den Inflation Reduction Act, kurz IRA. Insbesondere soll die Produktion von Wasserstoff angekurbelt werden. Aber der Teufel steckt im Detail.
Unter welchen Umständen bekommt Wasserstoff das Label “grün”, das ihm bescheinigt, zu 100 Prozent mit Wind- und Sonnenenergie hergestellt worden zu sein? Diese Bestimmungen muss die US-Steuerbehörde noch ausarbeiten, und zurzeit tobt ein Streit darüber. Sind sie zu restriktiv, könnte das den Ausbau der Wasserwirtschaft behindern. Sind sie zu lax, könnte sogar mehr CO₂ausgestoßen werden als mit konventionellen Methoden …

Die Mathematik der Fairness
Egal ob Menschen oder Maschinen Entscheidungen treffen: Es besteht immer die Gefahr, dass bestimmte Gruppen benachteiligt werden. Lässt sich Fairness überhaupt erreichen?
Dieses interaktive „Scrollytelling“-Projekt, habe ich im Rahmen meines Stipendiums im MIP.labor an der FU Berlin erstellt. Es steht unter einer Creative-Commons-Lizenz, kann also unter gewissen Bediungungen honorarfrei weiter verbreitet werden!
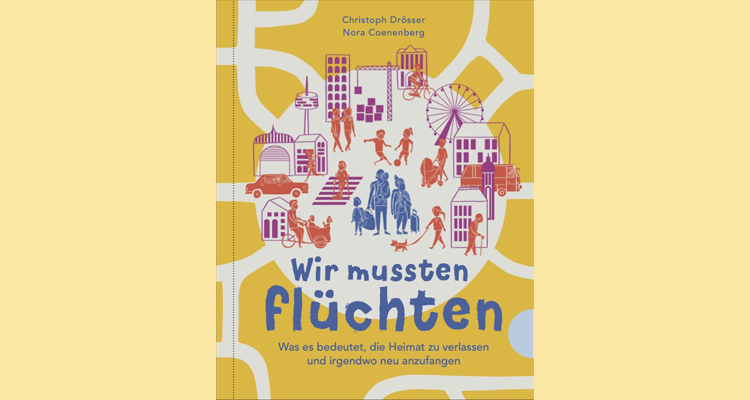
Wir mussten flüchten
Fast jedes Kind kommt in der Schule in Kontakt mit geflüchteten Kindern, zum Beispiel aus der Ukraine. Doch was haben sie auf der Flucht erlebt und warum sind sie hier? Dieses Buch zeigt anschaulich, was es heißt, fliehen zu müssen und irgendwo neu anzufangen. Es erklärt, was in der Genfer Flüchtlingskonvention steht, wie ein Flüchtlingslager aussieht und wirft einen Blick zurück in die Geschichte. Ganz praktisch wird es zum Schluss: Die Kinder erfahren, wie jede und jeder von uns den Geflüchteten das Einleben erleichtern kann und wie man Vorurteilen entgegenwirkt.
Ein Kinderbuch für den Thienemann-Verlag.
https://www.thienemann.de/produkt/wir-mussten-fluechten-isbn-978-3-522-30633-1
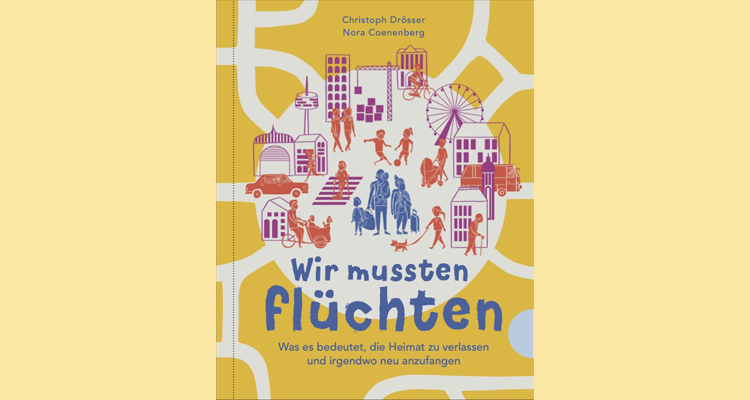
Wir mussten flüchten
Fast jedes Kind kommt in der Schule in Kontakt mit geflüchteten Kindern, zum Beispiel aus der Ukraine. Doch was haben sie auf der Flucht erlebt und warum sind sie hier? Dieses Buch zeigt anschaulich, was es heißt, fliehen zu müssen und irgendwo neu anzufangen. Es erklärt, was in der Genfer Flüchtlingskonvention steht, wie ein Flüchtlingslager aussieht und wirft einen Blick zurück in die Geschichte. Ganz praktisch wird es zum Schluss: Die Kinder erfahren, wie jede und jeder von uns den Geflüchteten das Einleben erleichtern kann und wie man Vorurteilen entgegenwirkt.
Ein Kinderbuch für den Thienemann-Verlag.
https://www.thienemann.de/produkt/wir-mussten-fluechten-isbn-978-3-522-30633-1
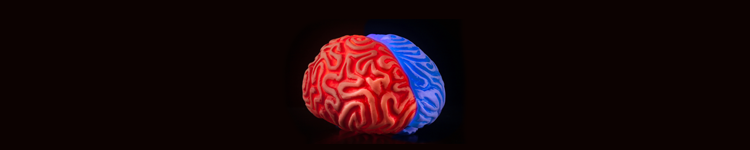
Der, die, das Gehirn – hat das Denken ein Geschlecht?
Kann eine Pathologin feststellen, ob das Gehirn auf ihrem Labortisch von einem Mann oder einer Frau stammt? Kann ein Radiologe an einem Gehirnscan das Geschlecht einer Person ablesen?
Unter Forschenden wird kontrovers diskutiert, ob sich die Denkorgane der Geschlechter grundsätzlich unterscheiden. Denn damit wird auch die Frage berührt, ob Männer und Frauen aus biologischen Gründen unterschiedlich denken oder ob Unterschiede nur auf ihre Sozialisierung zurückzuführen sind.
Zum Thema habe ich auch einen Artikel bei den Riffreportern geschrieben.

It’s never too late – Wie Erwachsene neue Sprachen lernen
Kinder saugen fremde Sprachen auf wie ein Schwamm, wenn sie zum Beispiel mit ihrer Familie ins Ausland ziehen. Akzentfrei und grammatisch korrekt. Erwachsene hingegen tun sich erheblich schwerer, Fremdsprachen zu lernen.
Sie müssen Vokabeln und Regeln pauken. Aber mit Motivation und der richtigen Lernumgebung können auch sie es schaffen. Eine gute Aussprache ist im Alter allerdings schwerer zu erlernen.
Welche Lernmethoden sind für Erwachsene angemessen? Und was bringen die Sprachlern-Apps fürs Smartphone?
Ein Radiofeature für SWR2 Wissen.

„Das Bild von Winnetou aus dem Hirn wegschieben“
Die „Winnetou-Debatte“ hat es wieder gezeigt: Die Deutschen hängen sehr an ihren Stereotypen und wollen sich ihre Indianerspiele nicht nehmen lassen. Hartmut Lutz kämpft seit 40 Jahren gegen die „Indianertümelei“.
Hartmut Lutz ist ein emeritierter Professor für amerikanische und kanadische Studien an der Universität Greifswald. Im Jahr 1985 habilitierte er sich mit der Arbeit „Indianer” und „Native Americans”: Zur sozial- und literaturhistorischen Vermittlung eines Stereotyps. Er hat die nordamerikanischen indigenen Völker, insbesondere in Kanada, häufig besucht und auch deren Vertreter nach Deutschland eingeladen.

Ich bin ein Riffreporter!
Die Riffreporter sind eine Plattform für freie Journalistinnen und Journalisten, die dort ihre Themen selbst anbieten und vermarkten. Ich bin zu dem munteren Haufen dazugestoßen, vor allem als Mitglied der Weltreporter, und werde die Geschichten, die ich dort schreibe, auch hier verlinken.

„Der Einfluss der russischen Tweets war, wenn überhaupt, begrenzt“
Wurde Donald Trump nur dank russischer Trolle US-Präsident? Das greife als Erklärung zu kurz, sagen einige Forscher. In einer Studie fanden sie dafür keine Anhaltspunkte.
Dass Donald Trump im Jahr 2016 zum US-Präsidenten gewählt wurde, lag auch daran, dass russische Akteure über Anzeigen und Social-Media-Posts die Wählerschaft beeinflusst hatten – das ist jedenfalls der Tenor ganzer Bücher zum Thema. Tatsächlich wiesen Forscher immer wieder nach, dass es groß angelegte Anstrengungen aus Russland gab, in sozialen Netzwerken Stimmung für Trump und gegen Hillary Clinton zu machen.
Schwieriger zu messen ist, wie groß der Einfluss der russischen Trollbotschaften tatsächlich war. Schon seit einiger Zeit gibt es Hinweise aus der Forschung, dass ihre Wirkung eher überschätzt wurde. Eine aktuelle Studie, veröffentlicht im Fachmagazin „Nature Communications“, kommt nun ebenfalls zu dem Ergebnis: Die russischen Anstrengungen bei Twitter hatten so gut wie keine Auswirkungen auf das Wahlergebnis.
Jan Zilinsky ist einer der Autoren der Studie. Der aus der Slowakei stammende Ökonom arbeitet an der School of Social Sciences & Technology an der TU München. Dort beschäftigt er sich mit der Frage, wie die Meinungsbildung von Bürgerinnen und Bürgern beeinflusst wird …
Dazu habe ich auch einen Radiobeitrag beim Deutschlandfunk gemacht.