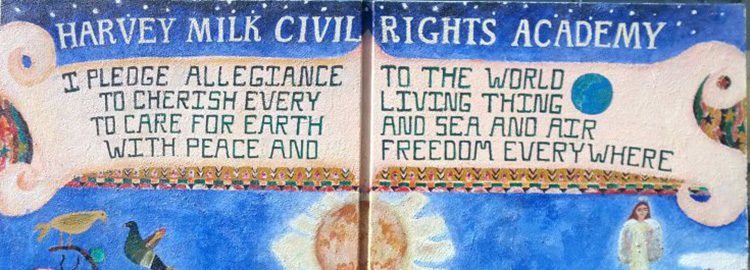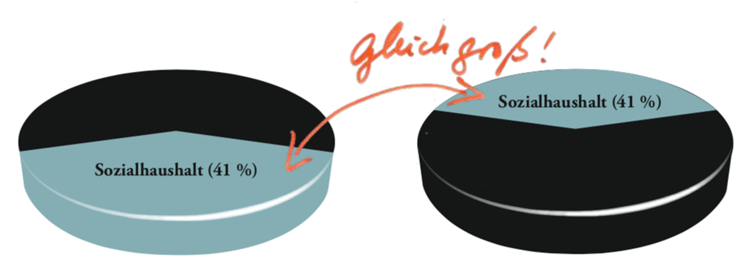NZZ Folio
Im Internet Archive in San Francisco wird alles gespeichert, was im Netz auftaucht und verschwindet – es ist eine digitale Bibliothek von Alexandria.
Das Internet vergisst nichts – der Satz könnte falscher nicht sein. Gut, manchem mag ein Bild aus vergangenen Tagen peinlich sein, das plötzlich wieder zum Vorschein kommt. Aber viel häufiger ist der Fall, dass man eine Seite aufrufen will und die berüchtigte Meldung erhält: «404 – File not found». Eine Website lebt im Durchschnitt 100 Tage, bevor sie verschwindet oder verändert wird. Das Internet ist sehr vergesslich.
Brewster Kahle kämpft dagegen, seit 1996. In jenem Jahr gründete er das Internet Archive, ein Archiv des weltweiten Netzes, das die Nutzer vor allem durch die Wayback Machine kennen: Stossen sie beim Stöbern im Netz auf die 404-Seite, dann können sie die Adresse in diese Suchmaschine der besonderen Art eingeben und vergangene Versionen der Seite abrufen, häufig mehrere. Nicht das ganze Netz, aber die unvorstellbare Zahl von einer Milliarde Websites besucht der Kriech-Algorithmus des Archivs in regelmässigen Abständen und speichert ihren Inhalt …