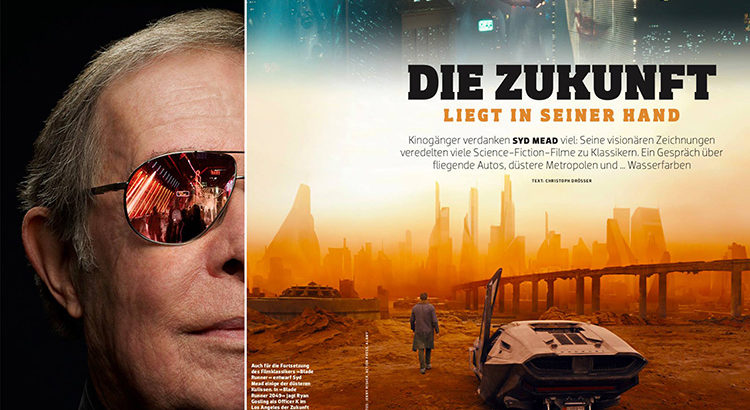Zeit Online
Der Facebook-Skandal geht weit über den fehlenden Datenschutz hinaus, sagt Silicon-Valley-Insider Hugh Dubberly. Den Tech-Konzern zähmen könne nur Europa.
Hugh Dubberly gestaltet das Silicon Valley seit mehr als 30 Jahren mit: Er verantwortete das Design der frühen Apple-Produkte und gestaltete den Internetbrowser Netscape. Heute berät er mit seiner eigenen Agentur unter anderem Google, Amazon und Facebook.
ZEIT ONLINE: Mr. Dubberly, Mark Zuckerberg schrieb am Mittwoch auf Facebook: „Es ist unsere Verantwortung, eure Daten zu schützen, und wenn wir das nicht können, verdienen wir es nicht, euch zu dienen.“ Also: Verdient Facebook es noch, uns zu dienen? Oder was muss geschehen, damit sie es wieder verdienen?