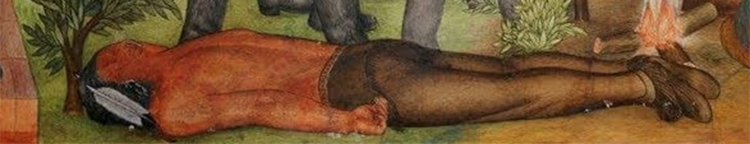Deutschlandfunk Kultur
Etwas läuft schief im Internet, hat der Autor James Bridle bereits vor zwei Jahren festgestellt. In seinem Buch „New Dark Age“ plädiert er dafür, sich kritischer mit Technologie zu beschäftigen. Doch einfache Lösungen gibt es nicht.
„Ich plädiere für eine nachdenklichere Beschäftigung mit Technologie, gepaart mit einem radikal anderen Verständnis dessen, was sich über die Welt denken und wissen lässt“, schreibt der Vordenker James Bridle in seinem neuen Buch und hinterlässt uns nachdenklich in die schöne neue digitalisierte Welt.
James Bridle kam Ende 2017 zu kurzer Berühmtheit im Internet, als er einen Artikel auf der Website Medium veröffentlichte: „Something is wrong on the internet“ – etwas läuft schief im Internet. Bridle berichtet darin von einer Expedition in die Tiefen von YouTube …