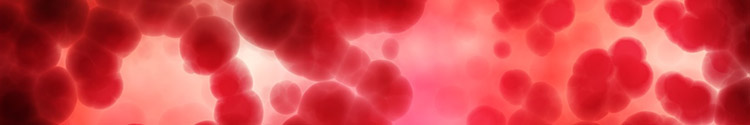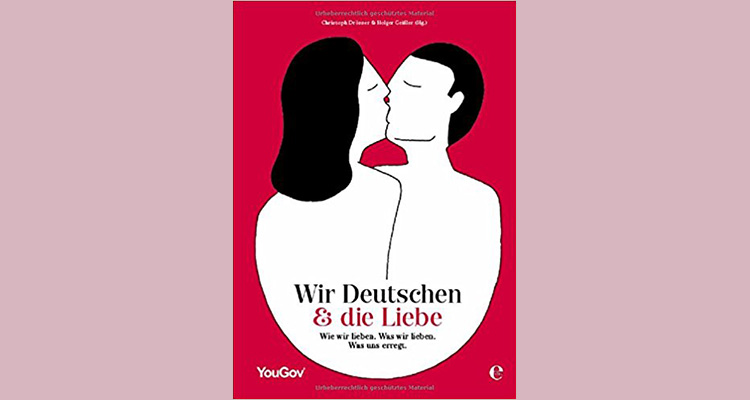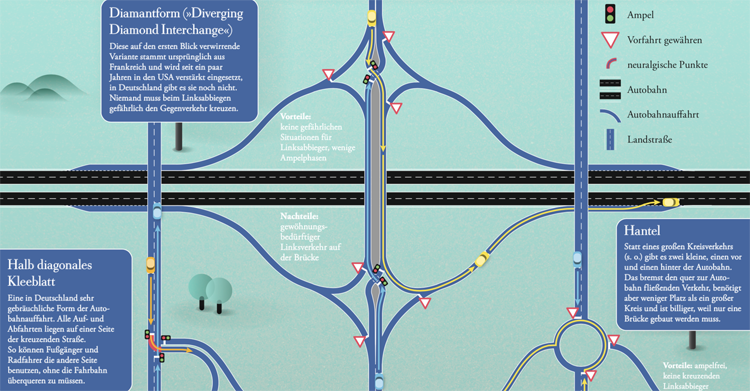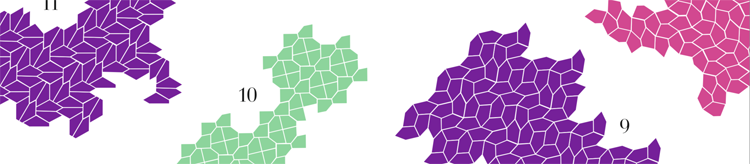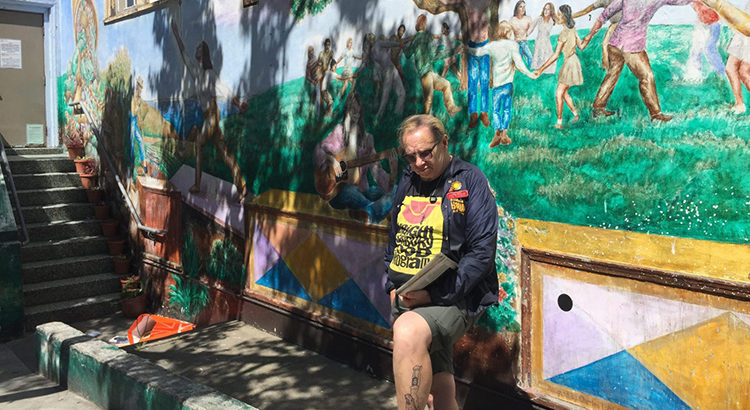Deutschlandfunk
Spritzt man alten Mäusen Blut junger Artgenossen, finden sie besser durch Labyrinthe. Diese Beobachtung testen zwei Forscher in den USA derzeit auf Tauglichkeit als potenzielle Abhilfe gegen Altersdemenz bei Menschen – und fühlen sich durch eine erste Studie bestätigt.
„Blut ist ein ganz besonderer Saft“, sagte Mephistopheles in Goethes „Faust“ und ließ diesen den Teufelspakt mit Blut unterschreiben. Blut ist das Elixier des Lebens, dachte sich auch Anfang des 17. Jahrhunderts die ungarische Gräfin Elisabeth Báthory, die angeblich junge Frauen töten ließ, um in ihrem Blut zu baden. Sie erhoffte sich, davon wieder jünger zu werden. Wirklich teuflisch.
Ganz so brutal ist der Schweizer Forscher Tony Wyss-Coray, der im kalifornischen Stanford forscht, bei seinen Experimenten nicht vorgegangen. Aber ein bisschen makaber waren die auch: Der Mikrobiologe nähte Mäuse paarweise zusammen, immer eine junge und eine alte Maus, so dass sie einen gemeinsamen Blutkreislauf hatten. Parabiose nennt man das. Die Folge: Bei der alten Maus, die schon Zeichen von Demenz zeigte, bildeten sich neue Hirnzellen …